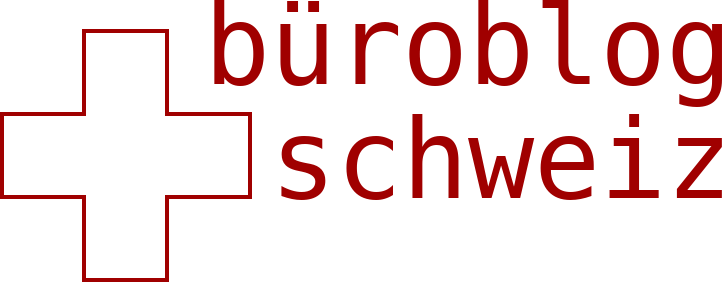Die Büroarbeitswelt hat in den letzten Jahren eine starke Disruption erlebt. Wohin die Reise geht, ist momentan noch nicht abzusehen. Eine aktuelle Studie des Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) zeigt auf, welche Faktoren zukünftige Offices beeinflussen werden.

Kaum jemand arbeitete während der Covid-19-Pandemie der Jahre 2020 und 2021 so, wie in der Zeit davor. Die beiden Autoren Karin Frick und Detlef Gürtler der vom Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) im Auftrag des Schweizer Büromöbelverbands veröffentlichten Studie „OH! FFICE. Die Zukunft des Arbeitsortes zwischen Ausnahmezustand und New Normal“ gehen deshalb davon aus, dass sich mit dem Ende der Pandemie die Office-Landschaft noch einmal drastisch verändern wird: Sie wird weder zu dem Zustand vor 2020 zurückkommen, noch den Ausnahmezustand einfach fortsetzen.
Triebkräfte für den Strukturwandel
Seit dem Siegeszug des Personal Computers hat kein einzelnes Ereignis die Office-Landschaft so stark verändert wie die Covid-19-Pandemie. Die massiven Verlagerungen von Erwerbsarbeit (mehr Homeoffice, weniger Business-Travel) werden auch weit über das Ende der Pandemie hinaus Triebkräfte für den Strukturwandel der Büroarbeit sein, stellen die beiden Autoren fest.
Die sich herausbildenden neuen Strukturen sind dabei auch stark von der ökologischen Transformation beeinflusst. Forderungen nach Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und Ressourceneffizienz lassen sich am besten durch eine intensivere Nutzung bereits vorhandener Flächen sowie die Einsparung unnötiger Mobilität erfüllen. Die Autoren der Studie erklären, dass die Kombination aus ökologischen und ökonomischen Triebkräften zu einer Auflösung der Bindung der Erwerbstätigkeit an einen einzigen Ort führen dürfte: Für unterschiedliche Funktionen stehen unterschiedliche Arbeitsorte zur Verfügung, beispielsweise ein Homeoffice für Kommunikation, ein wohnungsnaher Workspace für Konzentration, ein Zentralbüro für Interaktion, sowie ein Lab für Innovation – Workplace follows Function.
Funktion des Büros wandelt sich
Das traditionelle Büro verliert hierdurch nicht seine Existenzberechtigung, sondern verändert seine Funktion. Es soll weniger als bisher auf Konzentration und Kommunikation fokussieren – das kann in Remote- oder Homeoffices genauso gut oder sogar besser erreicht werden –, sondern vor allem Aktion und Interaktion ermöglichen. Für Brainstormings, Teamwork, gemeinschaftliche kreative Prozesse aller Art ist ein physisches Zusammentreffen in einem zentralen Büro weiterhin erste Wahl.
Gestaltung des Zusammenkommens
Durch diesen Funktionswandel wird die Büroarbeitszeit qualitativ aufgewertet. Um den so gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden, hat bereits ein Kuratierungsprozess begonnen: Das physische Zusammenarbeiten findet nicht mehr einfach so statt, sondern es wird gestaltet, heisst es in der Studie. Zu dieser Gestaltung gehört auch eine stärkere Rolle der Identität eines Unternehmens. Als „purposefocused space“ sollen Büros sicherstellen, dass die Mitarbeitenden sich mit dem Zweck eines Unternehmens in Verbindung bringen. Je weniger Zeit im traditionellen Büro verbracht wird, desto stärker sollte dessen Gestaltung eine Identifizierung mit der Mission eines Unternehmens ermöglichen.

Teilen von Arbeits- und Meetingflächen
Wenn Büroarbeit einerseits qualitativ aufgewertet wird, aber andererseits quantitativ einen deutlich geringeren Anteil an der gesamten Arbeitszeit einnimmt, dürften Büroflächen in Zukunft in deutlich grösserem Ausmass mit anderen Unternehmen oder Konzernbereichen geteilt werden, schlussfolgern die Autoren. Das gilt insbesondere für Sonderflächen wie Meeting- und Veranstaltungsräume. In diesem Segment können wiederum andere zentral gelegene Orte eine Rolle spielen, die ebenfalls Teil des postpandemischen Strukturwandels sind, etwa Business-Hotels oder Einkaufszentren.
Der Stuhl wird der neue Tisch
Bei der Ausstattung der nächsten Arbeitsplatzgeneration ist eine Bedeutungsverlagerung zu erwarten: Der Stuhl wird der neue Tisch. Sowohl Schreibtisch als auch Regal spielten eine Hauptrolle, solange es im Büro um die bestmögliche Verbindung von Kopf- und Handarbeit ging. Wenn hingegen nur noch entscheidend ist, was auf dem Bildschirm passiert, geht es vor allem darum, eine ausdauernde, konzentrierte und effiziente Bildschirmarbeit zu ermöglichen. Daraus ergibt sich für die Autoren, dass ein Möbelstück in die Office-Welt Einzug halten wird, das genau diese Voraussetzungen erfüllt – der Gaming-Chair.
Hier kann die Studie kostenlos heruntergeladen werden.